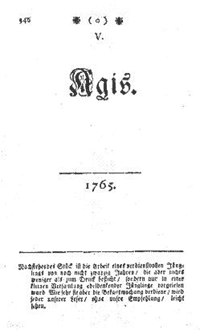Kindheit und Jugend in Zürich
1746-1768
Am 12. Januar 1746 wurde Johann Heinrich Pestalozzi in der Wohnung seiner Eltern am Oberen Hirschgraben in Zürich geboren. Die Familie besaß das Stadtbürgerrecht, seit der Vorfahr Johann Anton Pestalozzi in der Mitte des 16. Jahrhunderts aus Chiavenna nach Zürich eingewandert war, und verstand sich anfangs als Kaufmannsfamilie, die keine öffentlichen Ämter bekleidete. Erst Pestalozzis Großvater Andreas Pestalozzi studierte Theologie und wurde Pfarrer in Höngg bei Zürich, ein Amt, das nur Stadtbürgern offen stand.
Die ersten Lebensjahre Pestalozzis waren von großen familiären Turbulenzen geprägt: Sieben Kinder wurden in etwas mehr als acht Ehejahren der Eltern geboren, wovon vier auch in diesen Jahren starben, und Pestalozzi war erst fünf Jahre alt, als der Vater Johann Baptist Pestalozzi (1718-1751) starb. Die ökonomischen Verhältnisse waren für eine Stadtzürcher Familie schon zu Lebzeiten des Vaters recht bedrückend, da dieser als sog. "Chirurgus" seine Familie kaum ernähren konnte, und nach seinem Tod wurden sie noch bedrückender. Die Mutter zog mit ihren drei überlebenden Kindern nicht zu ihrer besser gestellten Verwandtschaft nach Richterswil am linken Ufer des Zürichsees, die zwar der bedrängten Familie materiell half, aber selbst kein Stadtbürgerrecht besaß. Wohl wegen der besseren Bildungschancen und des besseren Schulangebots für die Kinder blieb die als Stadtbürger immer noch privilegierte Familie in Zürich wohnen. Die ärmlichen Verhältnisse führten aber zusammen mit den traumatischen familiären Erfahrungen zu einer ängstlichen Fürsorge durch die Mutter und die treue Magd des Hauses, Barbara Schmid. So durchlebte Pestalozzi als Kind die öde Langeweile und Erfahrungseinschränkung einer zu weit getriebenen Behütung und beschreibt 1804 in der Rückschau seine Situation in einer Zuschrift an Hans Konrad Escher (von der Linth):
"Meine Jugendjahre versagten mir alles, wodurch der Mensch die ersten Grundlagen einer bürgerlichen Brauchbarkeit legt. Ich war gehütet wie ein Schaf, das nicht außer den Stall darf. Ich kam nie zu den Knaben meines Alters auf die Gasse, kannte keines ihrer Spiele, keine ihrer Übungen, keines ihrer Geheimnisse. Natürlich war ich in ihrer Mitte ungeschickt und ihnen selbst lächerlich. Auch gaben sie mir im neunten oder zehnten Jahr schon den Namen 'Heiri Wunderli von Thorlicken'." (PSW 29, S. 104).
Und an anderer Stelle führt er um dieselbe Zeit aus:
"Das Alltägliche und Gemeine, wodurch die meisten Kinder im Hause und außer demselben im Angreifen und Behandeln von tausenderlei Dingen zu den gewohnten Fertigkeiten des Lebens, beinahe ohne daß sie es wissen und wollen, zum voraus vorbereitet und tüchtig gemacht werden können, mangelte mir ganz. Da in meiner Kinderstube eigentlich so viel als nichts dafür vorhanden war, mich vernünftig und lehrreich zu beschäftigen, und ich mit meiner Lebhaftigkeit gewöhnlich das verdarb und zugrunde richtete, was ich ohne diesen Zweck in meine Hand kriegte, so glaubte man, das beste, was man diesfalls an mir tun könne, sei, zu machen, daß ich so wenig wie möglich in die Hände nehme, damit ich so wenig als möglich verderbe. 'Kannst du denn auch gar nicht still sitzen. Kannst du denn auch gar nicht die Hände still halten?' Das war das Wort, das ich bald alle Augenblicke hören mußte. Es war meiner Natur zuwider, ich konnte nicht stille sitzen, ich konnte die Hände nicht stille halten, und wahrlich, je mehr ich es sollte, desto weniger konnte ich es. Wenn ich nichts mehr fand, so nahm ich eine Schnur und drehte so lange an ihr, bis sie keiner Schnur mehr gleich sah. Jedes Blatt, jede Blume, die in meine Hand kam, hatte das gleiche Schicksal. Denke dir den Fall, wo man ein in vollem Trieb sich befindendes Räderwerk in seinem Laufe gewaltsam verwirrt und hemmt und das Streben dieser Räder gegen die Hemmung ihrer Kraft, so hast du das Bild des Einflusses meiner Lage auf die Richtung meiner nach Entwicklung und Tätigkeit strebenden Kräfte. Je mehr diese gehemmt wurden, je verwirrter und gewaltsamer erschienen sie, wo sie sich immer zeigen wollten und zeigen konnten."
Pestalozzi besuchte in seiner Heimatstadt Zürich alle Schulen, die damals einem intelligenten jungen Bürger der Stadt zum unentgeltlichen Besuch offen standen, und sein Bildungsgang führte ihn über die Schola Carolina im Großmünster zum Studium am Collegium Carolinum, einer Schule mit Hochschulcharakter, dessen Lehrer den Geist der schweizerischen bzw. zürcherischen Aufklärung prägten. Zuerst wollte Pestalozzi wie sein Großvater Pfarrer werden, dann begann er, die Rechte zu studieren. Sein berühmtester Lehrer war der weit über die Grenzen Zürichs und der Schweiz hinaus bekannte Johann Jakob Bodmer (1698 - 1783), der eine Gruppe begabter Studenten um sich scharte.
Sie trafen sich wöchentlich einen Abend in der Zunftstube der Gerber, nannten sich "Helvetische Gesellschaft zur Gerwe" oder kurz "Patrioten" und gaben eine eigene Zeitschrift - den "Erinnerer" - heraus. Im Kreise der Patrioten wurden die Gedanken der alten und neuen Philosophen eingehend diskutiert: Platon, Titus, Livius, Sallust, Cicero, Comenius, Macchiavelli, Leibniz, Montesquieu, Sulzer, Hume, Shaftesbury, Lessing und vor allem und immer wieder Jean-Jacques Rousseau. Bei ihnen lernten die jungen Menschen hohe Lebensideale und weitsichtige gesellschaftliche Entwürfe kennen, die sie dann mit der Lebenswirklichkeit in ihrer Stadt und deren Umgebung verglichen: In Zürich lag die Macht in der Hand weniger führender Geschlechter der Stadt, und wer Kritik übte oder sich gegen die Willkür der Mächtigen zur Wehr setzte oder auch nur das bestehende Recht einforderte, musste mit Verfolgung und Verbannung rechnen. Die Bauern aus den umliegenden Dörfern mussten ihre Produkte zu vorgeschriebenen Preisen in der Stadt verkaufen und einen Großteil ihres Bedarfs wiederum durch Käufe in der Stadt decken. Eigentlicher Handel oder größeres Gewerbe war nur den privilegierten Bürgern der Stadt gestattet, und ebenso kamen für die Besetzung der kirchlichen und staatlichen Stellen - Pfarrämter, Gerichte und Verwaltung - nur Stadtbürger in Frage. Die freie Meinungsäußerung war durch eine strenge Zensur stark eingeschränkt. Die "Patrioten" rückten in ihren wöchentlichen Gesprächen der selbstherrlichen Regierungsweise der herrschenden Klasse zu Leibe, die auch nervös reagierte. Aber die Studenten ließen sich nicht abschrecken, und den weit über Zürich hinaus bekannten Bodmer wagten die "Hohen Herren" nicht anzutasten. Zweifellos hat sich Pestalozzi in seiner Heimatstadt durch seinen Eifer für geläuterte Sitten in Gesellschaft und Staat und seine Offenheit für die Ideen von Staatsreform und gerechter Herrschaft, von Gleichheit, Gewaltenteilung oder der Beendigung der offensichtlichen Ausbeutung der Landschaft und ihrer Bewohner nicht bloß unbeliebt gemacht, sondern auch seine Chancen auf ein öffentliches Amt, das ihm grundsätzlich als Stadtbürger offen gestanden hätte, frühzeitig und dauerhaft verscherzt.
Aus dieser Zeit sind die ersten gedruckten Schriften Pestalozzis erhalten: "Agis" und "Wünsche".
"Agis" ist Pestalozzis frühestes erhaltene Werk und erschien 1765, wohl um der Zürcher Zensur zu entgehen, im Lindauer Journal. Die Reformpolitik des Spartanerkönigs Agis scheitert am Widerstand der herrschenden und besitzenden Aristokratie, und Pestalozzi betont mit feiner Ironie sehr geschickt die Parallele zu Zürich, indem er sagt, dass es sich dabei aber um "keine Satyre auf unsere Umstände" handele. Auch die "Wünsche", eine Folge von aphoristischen Skizzen aus dem Erinnerer, 1766, macht Pestalozzis kritische Ausrichtung deutlich. Die Schrift beginnt:
"Ein junger Mensch, der in seinem Vaterland eine so kleine Figur macht, wie ich, darf nicht tadeln, nicht verbessern wollen; denn das ist außer seiner Sphäre. Das sagt man mir fast alle Tage; aber wünschen darf ich doch? - Ja, wer wollte mir das verbieten, das übel nehmen können? Ich will also wünschen und meine Wünsche den Leuten gedruckt zu lesen geben; und wer mich mit meinen Wünschen auslacht, dem wünsche ich - gute Besserung!" (PSW 1, S. 25).
Am meisten beeindruckte die Zürcher Studenten Jean-Jacques Rousseau. 1762 waren der "Gesellschaftsvertrag" und der "Émile" erschienen, beide Werke belebten in ihnen das Ideal eines natürlichen, tugendhaften und freien Lebens. Das Leben der Stadtmenschen erschien ihnen als verzerrt, verdorben und verkünstelt; der Bauer hingegen lebte - zumindest in ihrer Phantasie - einfach, kraftvoll und in engster Verbindung mit der Natur. Bei Pestalozzi griff dieser Gedanke tiefer und verband sich mit seinem Drang, den Armen und Rechtlosen auf dem Lande helfen zu wollen. In Höngg, der Pfarrei seines Großvaters, wo er als Kind oft zu Besuch war, hatte er die bedrückende Situation der ungebildeten und rechtlosen Landbevölkerung aus der Perspektive eines privilegierten Stadtkindes hautnah erfahren. So brach er seine Studien schon als Einundzwanzigjähriger vorzeitig ab und entschloss sich, selbst Bauer zu werden. Nicht Bauer im üblichen Verständnis des Berufs, sondern eher als Herr über ein Landgut, aus dessen Ertrag sich der Lebensunterhalt eines gebildeten und vielseitig interessierten Stadtbürgers erwirtschaften ließ. Allerdings fehlten Pestalozzi für diesen Weg alle Voraussetzungen, vor allem die Kenntnisse der Landwirtschaft und des Landbaus. So begann er im Sommer 1767 bei Johann Rudolf Tschiffeli im bernischen Kirchberg eine landwirtschaftliche Lehre, um dort den modernen Obst- und Feldbau zu erlernen.
Die Landwirtschaft befand sich im Gefolge der Aufklärung und des Aufkommens der Naturwissenschaften in einem grundlegenden Umbruch: Abkehr von der traditionellen Dreifelderwirtschaft zu Gunsten einer intensiveren Nutzung des Bodens durch gezielte Düngung und durch Verzicht auf das Ruhejahr. Tschiffeli war eine der treibenden Kräfte dieser Entwicklung, und Pestalozzi gedachte in seine Fußstapfen zu treten. Begünstigt wurde Pestalozzis Entschluss durch die positive philosophische Grundlegung der Landwirtschaft: Hatte der Merkantilismus als Wirtschaftslehre des französischen Absolutismus die Edelmetallreserven als das Fundament des volkswirtschaftlichen Wohlstands erklärt, so wurde dem im Gefolge von Rousseau von den Physiokraten widersprochen. Ihrer Überzeugung nach beruhte der Wohlstand einer Gesellschaft auf den natürlichen Erzeugnissen des Bodens, vorab auf einer gesunden Landwirtschaft, weshalb es als erste Aufgabe der Volkswirtschaftspolitik angesehen wurde, die Landwirtschaft zu modernisieren. Der Physiokratismus forderte zudem den Abbau der staatlichen Zwangswirtschaft (fehlende Handels- und Gewerbefreiheit; Kontrolle der Produktion durch Zünfte) und die Förderung der privaten Wirtschaft, um durch das "freie Spiel der Kräfte" zu einem natürlichen Gleichgewicht im Bereiche der Ökonomie zu kommen. Die optimale Befriedigung der wirtschaftlichen Bedürfnisse des Volks sollte das Ergebnis eines freien marktwirtschaftlichen Wettbewerbs und eines internationalen Freihandels sein.
Wenn sich Pestalozzi bereits mit 21 Jahren um eine praktische Berufstätigkeit bemühte, die auch ökonomisch etwas abzuwerfen versprach, hatte dies neben der modischen Schwärmerei für das Leben der Bauern und neben seinem Drang, der Landbevölkerung durch das gute Beispiel zu helfen, einen weiteren und ganz handfesten Grund: Er hatte sich verliebt, wollte heiraten und seine zukünftige Familie standesgemäß unterhalten können. Angefangen hatte Pestalozzis Liebe zur bereits 29jährigen Anna Schultheß 1767 beim Tode ihres gemeinsamen Freundes Johann Kaspar Bluntschli, genannt Menalk, der bereits mit 23 Jahren einem Lungenleiden erlegen war. Menalk hatte im Kreise der Patrioten seine Freunde durch sein eigenes Vorbild zur Arbeit an sich selbst ermutigt. Im Angesicht seines frühen Todes sah Bluntschli im zwei Jahre jüngeren Freund so etwas wie den Vollstrecker seiner eigenen hohen Ideale, was Pestalozzis Entschluss festigte, sich bedingungslos für die Verbesserung der sozialen und politischen Zustände einzusetzen, auch auf die Gefahr seines eigenen Lebens hin. Der Tod des gemeinsamen Freundes traf beide tief, und Pestalozzi fühlte sich Anna Schultheß in diesem Schmerz verbunden. Unversehens weckte die gemeinsame Trauer in Pestalozzi die Liebesleidenschaft, die ihn mit der Gewalt eines Vulkans zu verschlingen drohte. So lesen wir in einem der ersten Briefe an seine künftige Ehefrau:
Mademoiselle! Ich suche vergeblich meine Ruhe wieder. Ich sehe es, meine Hoffnungen sind verloren. Ich werde die Strafe meiner Unbedachtsamkeit mit einem ewigen Kummer büßen. Ich habe es gewagt, Sie anzustaunen, mit Ihnen zu reden, Ihnen zu schreiben, Ihre eigenen Empfindungen zu denken, zu fühlen, Ihnen zu sagen. - Ich sollte die Schwäche meines Herzens gekannt und solche Gefahren ausgewichen haben, wo jede Hoffnung verschwindet. Was soll ich nun tun; soll ich schweigen und mit stillem Gram mein Herz verzehren und nicht reden und keine Hoffnung, keine Erleichterung meines Elends erwarten? Nein! ich will nicht schweigen, es wird Erleichterung für mich sein, wenn ich es weiß, daß ich nichts hoffen darf. - Aber was hoffen? Nein! ich darf nichts hoffen! Sie haben Menalk gesehen, und ihm gleich muß der Mann sein, den Sie lieben können. Und ich! Wer bin ich? Welcher Abstand! Wie fühle ich schon den Todesstreich der grausamsten Worte, daß ich Menalk nicht gleich, daß ich Ihrer unwert [bin]! Ich weiß es; ich verdiene diese Antwort, ich werde sie erhalten; ich erwarte nichts anderes. [...] Den ganzen Tag gehe ich ohne Beschäftigung, ohne Arbeit, gedankenlos immer seufzend umher, suche Zerstreuung und finde sie nicht, nehme Ihren Brief, lese ihn, lese ihn wieder, träume, habe Hoffnung, habe dann wieder keine, betöre eine zärtlich ängstliche Mutter mit Erzählung von den Gründen einer Krankheit, die ich nicht kenne, fliehe den Umgang mit meinen Freunden, fliehe die Heiterkeit des Tags, sperre mich ins einsamste, dunkelste Zimmer, werfe mich auf das Bett hin, finde keinen Schlaf, keine Ruhe; ich verzehre mich selbst. Ich gedenke den ganzen Tag nur an Sie, an jedes Wort, das Sie redeten, an jeden Ort, da ich Sie sah. Ich habe alle Stärke, alle Beruhigung in mir selbst verloren und hänge ganz von Ihnen ab. O wie klein, wie verachtungswürdig muß ich mich Ihnen in dem Augenblick, da ich Ihre Hochachtung zu erlangen suche, zeigen. O, daß Sie meine Empfindlichkeit nicht gekannt, o, daß Sie es nicht gedacht haben, welche Gefahr Ihre Freundschaft meinem zu fühlbaren, o zu sehr fühlbaren Herzen sein werde! - Sie gossen Ihre Empfindungen für Menalk in meinen Schoß aus; ich fühlte die gleichen mit Ihnen; Sie hörten meine und fanden die Ihren darin! Was habe ich getan? Was haben Sie getan! Meine Hochachtung für Sie ist nun die gewaltige Leidenschaft der Liebe. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick erhöht sie sich. Es war nicht genug, mich zu erdrücken, daß ich Menalk verlieren werde: ich muß unter zweifachem Kummer zweifach ohne alle Hoffnung erliegen. [...]
Dreimal habe ich schon an Sie geschrieben und dreimal den Brief wieder zerrissen; den will ich nicht mehr zerreißen. Ich halte es für meine Pflicht, jetzt zu reden, da ich nicht mehr anders als mit Gefahr meiner Gesundheit und meines moralischen Zustands schweigen könnte. Sie kennen mein Herz; Sie wissen, wie fern es von aller Verstellung. Sie kennen meine Schüchternheit; Sie wissen gewiß, welche Überwindung es mich gekostet, mich zu diesem Schritt zu entschließen. Mehr will ich mich nicht entschuldigen.
Gütiger Himmel, stehe mir bei, mit Gelassenheit die wichtige Antwort zu erwarten. Und Sie, beste Schulthess! Eilen Sie, mich mir selbst wieder zu schenken. O Stunden, Augenblicke zwischen der Entscheidung! Mein Herz klopft; wie werde ich sie ertragen. Mein Glück, meine Ruhe, die Zukunft, ich, ich ganz, hänge von dieser Antwort ab.
Eilen Sie, ich bitte Sie auf den Knien, zu antworten Ihrem P.!" (PSB 1, S. 3-5).
Anna und Heinrich waren ein sehr ungleiches Paar: Sie eine Stadtschönheit, daran gewöhnt, immer genug Geld zu haben, intelligent und gebildet, fromm, feinsinnig und empfindsam, einerseits eher kühl und Distanz gebietend, andererseits ebenso wie Pestalozzi zum Zorn neigend - er körperlich unansehnlich, in mancher Hinsicht unbeholfen, in anderer jedoch hoch begabt, erfüllt von hochfliegenden Plänen zur Verbesserung der Welt, arm und Sohn einer Witwe, deren Geschlecht in der Stadt nichts zu sagen hatte. Auch aus Annas Sicht bestand zwischen ihr und Pestalozzi ein deutlicher Standesunterschied, weshalb sie, als es zu den ersten Kontakten kam, darauf drang, die Liebschaft ringsum zu verheimlichen. Als die Eltern Schultheß von Pestalozzis Absichten erfuhren, warfen sie ihn aus dem Haus und verschlossen ihm hinfort die Tür.
So blieb den beiden nichts anderes übrig, als sich im Versteckten zu treffen und einander täglich oder wöchentlich zu schreiben. Aus der Zeit zwischen Frühjahr 1767 und ihrer Heirat im September 1769 sind heute noch 468 Briefe erhalten, die über 650 Buchseiten füllen. Die leidenschaftliche Liebe Pestalozzis zu Anna, ihr anfängliches Widerstreben und ihr allmähliches, eher kühles Entgegenkommen, dann der Durchbruch ihrer Liebesleidenschaft, das Aufblühen einer beiderseitigen Zuneigung voller Poesie, Humor und Zärtlichkeit, dann ihr gemeinsames Ringen um Wahrheit und Tugend und ihr Kampf für ihre Liebe gegen die reichen Eltern Schultheß mit allen Demütigungen und Verletzungen - all dies lässt keinen unberührt, der heute diese Briefe liest. Sie offenbaren eindrücklich Pestalozzis reiches Innenleben, seine Hochherzigkeit, seine Sorge um die eigene Tugend, aber auch sein Wissen um seine höhere Berufung für das Volk. Die in diesen Briefen enthaltenen Selbstreflexionen sind autobiographische Zeugnisse von seltenem Wert. In einem ausführlichen Brief des einundzwanzigjährigen Pestalozzi, in dem er sich selbst schonungslos charakterisiert, kompromisslos seine Wertsetzungen klarstellt und seine Lebensvisionen entwirft, werden Grundzüge seines späteren Lebens erkennbar: Er will ohne Rücksicht auf seine Frau oder Kinder seinem Vaterland nützen, er weiß um seinen Eifer und seine Unbedachtsamkeit bei allem seinem Tun, er baut auf die Hilfe von Annas wohlhabender Verwandtschaft, er will Rousseaus Erziehungsvorstellungen umsetzen und seine Söhne nicht zu müßiggehenden Stadtmenschen werden lassen, und er schlägt depressive und schwermütige Töne an, indem er seine Schwäche, seine Krankheit und seinen baldigen Tod beschwört (vgl. PSB 1, S. 25-35).
Auch in späteren Briefen schwärmt er immer wieder von einer künftigen Zweisamkeit auf dem Lande, und wenn sich seine erträumten idyllischen Bilder dereinst auch als Illusionen erweisen sollten, so verraten sie doch seine sozialen Intentionen, die seiner Berufswahl zu Grunde liegen:
"Freundin, ich freue mich, daß Sie es für wahr finden, daß die Stadt nicht der Ort zu einer Auferziehung von unseren Absichten [ist]. Entschlossen soll meine Hütte diesem Zusammenfluß des Lasters und des Elends fern sein. In dieser einsamen Hütte soll dennoch das Vaterland mehr als in Getümmel der Stadt mich beschäftigen. Wenn ich einst auf dem Land bin und einen Sohn eines Mitbürgers sehe, der eine große Seele verspricht und der kein Brot hat, so führe ich ihn an meiner Hand und bilde ihn zum Bürger, und er arbeitet und ißt Brot und Milch und ist glücklich. Und wenn ein Jüngling eine edle Tat tut und den Haß seiner menschenfürchtenden Familie auf sich lädt, so soll er bei mir Brot finden, solange ich habe! Ja, mit Lust, Geliebte, trinke ich dann Wasser und gebe die Milch, die ich liebe, dem Edlen, daß er sehe, wie ich ihn schätze. Geliebte, dann würde ich Ihnen gefallen, wenn Sie mich so Wasser trinken sehen. Wirklich, Geliebte, wollen wir unsere Bedürfnisse, unseren Mitbürgern sehr zu dienen, so viel einschränken, als Anstand und Geschmack es dulden werden. Wie vieles, Geliebte, könnte ich hier schwatzen von dem Angenehmen dieser Tage und von dem Glück künftiger Kinder, von den angenehmen Überraschungen meiner Freunde. Aber ich schweige und sage Ihnen nur noch dieses, daß Umstände möglich, die mich in späten Jahren ab diesem Landsitz abrufen. Ich werde immer das tun, was ich als ein redlicher Bürger meinem Vaterland schuldig bin, und, Freundin, Ihnen ist die Erfüllung einer jeden Pflicht angenehm." (PSB 1, S. 60-61)
Anna hat Wochen und Monate gezweifelt, erwogen, gezaudert, bis sie sich ihrer Liebe sicher war und der erlösende Brief ist der erste, den sie datierte, 19. August 1767.
Kurz darauf, im September 1767, verließ Pestalozzi Zürich, um seine landwirtschaftliche Lehre anzutreten. Seine Briefe wurden Anna durch Freunde und Brüder im geheimen zugesteckt. Immer wieder wird deutlich, dass er seine Berufslehre als eine Vorbereitung zu einer Tätigkeit zum Wohle des Volks versteht und "daß der Endzweck seiner Unternehmungen das Glück vieler seiner Nebenmenschen zur Absicht hat" (PSB 1, S. 241). Aber nach nur neun Monaten - unterbrochen noch durch eine dreimonatige Winterpause - hielt Pestalozzi seine Lehre bereits für beendet, brach seinen Aufenthalt bei Tschiffeli ab, kehrte nach Zürich zurück und begann seinen Weg als landwirtschaftlicher Unternehmer.

Zum Autor
Name:
Dr. Arthur Brühlmeier
Mehr über den Autor
E-Mail schreiben

Zum Autor
Name:
Prof. Dr. Gerhard Kuhlemann
Mehr über den Autor
E-Mail schreiben